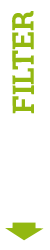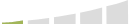In den aufgegebenen Steinbrüchen im Tiefental wurde der einzigartige Wehrer Lapillituff gebrochen
Nachdem wir den sakralen Teil des Eifelortes hinter uns gelassen haben, geht es auf breiten, teilweise geschotterten Feldwegen ins Tiefental hinein. Rechts und links der Route zeigen sich in stetigem Wechsel landwirtschaftliche Nutzflächen und Waldparzellen. Leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, da im Privatbesitz, geht es an mehreren aufgelassenen Steinbrüchen vorbei, die rechter Hand etwas versteckt im Wald liegen. Hier wurde bis in die 50iger Jahre des vorigen Jahrhunderts der einzigartige, nur im Wehrer Kessel anzutreffende graubraune Lapillituff gebrochen. Die pyroklastische Gesteinsart ist vulkanischen Ursprungs, recht porös und weist grobe Einschlüsse auf. Sie fand in der Ortschaft Wehr reichhaltige Verwendung beim Häuserbau. Bei der Errichtung des Probsteigebäudes und der Wehrer Pfarrkirche wurde ebenfalls Lapillituff verwendet, der womöglich in den Brüchen im Tiefental gewonnen wurde.

Auf dem Hohen Osterberg treffen die Wanderer auf die historisch bedeutsame Grenzziehung des Landgrabens
Durch das Tiefental weiterhin sanft bergauf wandernd gelangen die Wanderer im Talschluss zu den mächtigen Pfeilern der Tiefentalbrücke der L412. Wir unterschreiten das imposante Brückenbauwerk, wenden uns nach links und steigen recht steil zum Fuße der Kappiger Lay hinauf. Auf asphaltiertem Geläuf wird wenig später die B412 mittels einer Hochbrücke erneut gequert. Scharf links schwenkend geht es dann zum hohen Osterberg hinauf. Hier in der Germarkung Höwer Triesch treffen wir auf eine frei stehende Waldparzelle, die der historischen Grenzziehung des Landgrabens, in historischen Kartenwerken auch als "Landtwehr" bezeichnet, zuzuordnen ist. Von Namedy am Rhein bis nach Trier ist die mit Wällen und Befestigungsanlagen versehene Grenze anhand historischer Funde nachgewiesen. Die Erbauer dieser Grenzziehung sind leider im Dunkel der Geschichte verborgen geblieben.